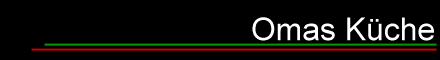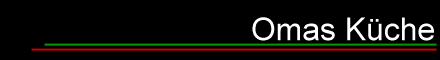|
Lappenkeuler – Magazin 10/2020
Gastbeiträge
Omas Küche
Ein Beitrag von Frau Julia Kardorf
Wie oft habe ich schon von Leuten gehört, dass ein Essen fast so gut geschmeckt hätte, wie damals bei der Oma oder bei der Großmutter. Ähnliche Behauptungen, nur unter etwas anderem Vorzeichen hört man auch oft: So gut wie Großmutter kochte, das gibt es heute gar nicht mehr – oder mit anderen Worten inhaltlich vergleichbar.
Immer wenn ich das höre, denke ich mir im Stillen, stimmt das wirklich? Hat Oma wirklich so toll gekocht? Also ganz ehrlich, ich habe da so meine Zweifel. Natürlich hatten andere andere Omas und nicht alle Omas sind gleich, trotzdem hört man immer wieder diese Sätze. Sie sind fast schon zu einem Leitmotiv von Hobbyköchen geworden. Wenn diese ein Essen zum ersten mal zu sich nehmen, was ihnen besonders gut schmeckt, kommt gleich der Satz: „Das schmeckt fast wie bei Großmutter.“
Der Sache will ich mal auf den Grund gehen. Dabei denke ich natürlich an meine eigenen beiden Omas, die mütterlicher- und väterlicherseits. In stillem Gedenken, beide sind schon lange tot. Darf ich jetzt nichts negatives sagen, nur weil es heißt, dass man über Tote niemals etwas schlechtes sagt? Vielleicht liegt ja schon da der Grund, warum Großmütter immer so großartig und lecker gekocht haben sollen, nur weil man über die lieben Verstorbenen nie schlecht redet? Es wirkt plausibel, ist es jedoch nicht wirklich, denn dann würde es ja genügen, wenn man bei einem besonderen Genuss Oma erst gar nicht erwähnt.
Also meine beiden Großmütter, wie war das da genau, mal ohne ethische Bedenken, nur sachlich betrachtet? Beginnen wir mal bei der Oma väterlicherseits, die gute Christiane. Schon 1995 war sie gestorben. Als Kind habe ich nur sehr gelegentlich bei ihr gegessen und, sorry Omi, das war gut so. Die Frau konnte definitiv nicht kochen. Sie konnte nicht schlecht kochen, sondern gar nicht kochen. Selbst das Zubereiten von Nudeln überforderte sie restlos. Grundsätzlich wurde daraus ungenießbare Matsche, weil sie die locker 20 bis 30 Minuten kochen ließ. Zum Ausgleich waren Kartoffeln grundsätzlich zu hart, weil nie gar gekocht. Bei Festivitäten gab es ihre berüchtigte Wurstplatte, bei der sich eigentlich nicht viel falsch machen ließ, weil sie frische Wurst vom Metzger kaufte, die auf einer Servierplatte zu Brot dargeboten wurde. Die Frau kaufte die Wurst jedoch eine halbe Woche vorher und arrangierte sie auf der Platte, um den Vorbereitungsstress auf mehrere Tage zu verteilen. Da die große Wurstplatte so nicht in ihren kleinen Kühlschrank passte, wurde sie bis zum Fest im Schlafzimmer unter dem Bett abgestellt. Wohlgemerkt ohne irgend eine schützende Folie drüber. Die Folgen waren klar: die Wurst war meist vergammelt und allein dadurch schon ungenießbar, hinzu kamen diverse Staubflusen und Wollmäuse die sich darauf versammelten. So manch einer hat nach dem Festschmaus heftig gekotzt. Selbst schuld, hieß es, denn wer die Oma kannte, der hat davon nichts gegessen. Das Thema Gemüse ist schnell durch, denn das gab es nahezu gar nicht. Bestenfalls ein paar Gürkchen aus dem Glas, dann hatte man einen guten Tag erwischt. Wenn sie Fleisch zubereitet hatte, war das grundsätzlich nie gar, wer Glück hatte, der erwischte ein Stück, an dem wenigstens außen etwas vom Rand leicht angegart war. Zum Glück machte sie nie Geflügel, weil sie das nicht mochte, denn dort wären solche Zustände tödlich gewesen, die Salmonellen lassen grüßen. Fisch mochte und machte sie ebenfalls grundsätzlich nie, weil ihr Leitspruch hieß: „Fisch gehört ins Wasser und nicht auf den Tisch“. Hinzu kam noch, dass sie Gewürze mied, auch die Verwendung von Zwiebeln und ähnlichen geschmacksbildenden Bestandteilen waren ihr völlig fremd. Eine Soße machen, das hieß für sie immer, viel Soßenbinder mit einem dicken Klumpen Margarine und einer Priese Salz in kochendem Wasser zubereiten, fertig war die Soße. Entsprechend der Geschmack, nach nichts oder irgendwie nach Pappe. Rundum gesagt, es gab von ihr kein einziges Essen, an welches ich mich gerne zurück erinnere. Essen bekam bei ihr eher immer etwas von einem Furchtzustand, den man mied, wenn es sich irgendwie einrichten ließ.
Doch kommen wir zum Vergleich jetzt mal zu der Großmutter mütterlicherseits, der auch schon längst verstorbenen Marianne. War es da besser? Es war anders, jedoch nicht wirklich besser. Die Marianne, möge sie in Frieden ruhen, hatte in Sachen Essen immer einen Leit–Grundsatz: Essen muss nicht schmecken, sondern satt machen! Diesen Spruch hörte man sehr häufig von ihr und genau danach handelte sie auch. Diese Einstellung lag sicherlich mit darin begründet, dass sie acht Kinder hatte, sieben Mädchen und einen Jungen, die altersmäßig alle wie die Orgelpfeifen gestaffelt waren und täglich zum Mittagstisch antraten und gesättigt werden wollten. Kochen ging bei ihr allerdings ganz anders, als bei Oma Christiane. Fast jeden Tag wurde von den beiden ältesten Töchtern ein Berg Kartoffeln sehr weich gekocht, die weichen Kartoffeln wurden dann mit irgend einem Gemüse, z.B. Möhren, Spinat, Kohlstückchen oder sonstigem, in einem riesigen Topf zu einer Pampe gestampft und vermengt, manchmal, meist sonntags, wurden auch noch ein paar Wurststückchen darunter gewürfelt und damit war das Mittagsmenü fertig. Gewürze waren, mit Ausnahme von Salz, auch hier eher ein Fremdwort. Wer glaubt, dass das doch schmecken könnte, der liegt gründlich daneben. Es schmeckte immer gleich: nach nichts. Es schmeckte nicht nach Kartoffeln, aber auch nicht nach dem Gemüse, was darunter war. Man hatte irgend eine warme, pampige Masse im Mund, nahezu geschmacklos. Aufgrund des fehlenden Geschmacks und der pappigen Konsistenz war man von dem Zeug dann auch freiwillig in nullkommanichts satt. Manchmal schon, bevor man überhaupt einen Happen davon gegessen hatte. Die Grundforderung, davon satt zu werden, war damit erfüllt und mehr brauchte es nicht. Einfach alles stehen zu lassen, war für die Kinder keine wirklich brauchbare Option, denn Reste wurden am Folgetag wieder mit unter die neue Pampe gemischt, bis das alles restlos weg war. Fleisch gab es exakt einmal im Monat an einem Sonntag, entweder gebratenes Huhn, wobei von den Überresten eine Hühnersuppe gekocht wurde oder ein gebratener Feldhase, den der Opa selbst erlegt hatte. Wer nun Gaumenfreuden erwartet, wird bitter enttäuscht. Die Sachen sahen manchmal sogar lecker aus, keine Frage, aber auch sie schmeckten in der Regel nach nichts. Wie man ein Menü so geschmacksneutral zubereiten kann, das ist mir bis heute ein unerklärbares Rätsel. Unbedingt erwähnt werden muss Oma Mariannes Nudelsalat, vor dem sich das halbe Dorf fürchtete. Hier gibt es gewisse Parallelen zur Oma Christiane. Da man Streß reduzieren wollte, indem man manche Sachen vorbereitete, kochte Oma Marianne einen riesigen Berg kleiner, krummer Nudeln, generell immer viel zu weich, dass sie fast schon von selbst zerfielen. Diese schon klatschig-matschigen Nudeln wurden dann mit Unmengen von Billigst – Mayonaise und Wurstresten vermischt, die sich im Laufe der Woche von den Frühstücks – Butterbroten angesammelt hatten. Je nach dem, was gerade übrig war, kamen auch schon mal Käsestückchen, Apfelfragmente oder sonstige Obst – Reste darunter. Alles vermengen und dann ein paar Tage im Flurschrank stehen lassen, weil es dort kühler war, damit sich der Geschmack setzen konnte, wie sie das nannte. Ich würde wetten, das damals jeder schon mindestens einmal danach gekotzt hat.
Auch berüchtigt ihre unschlagbaren Eintöpfe. Alles in kochendem Wasser stundenlang mit brodeln lassen, was man so an Gemüseresten usw. aus dem eigenen Garten hatte, irgendwelche Knochenreste dazu, die es beim Metzger für ein paar Pfennige gab, und tatsächlich entstand daraus etwas mit Geschmack, was man sonst von ihr nicht gewohnt war. Ich habe nicht behauptet, mit gutem Geschmack, aber immerhin, es war ein Geschmack vorhanden, der meist im Hintergrund leicht etwas von Sellerie hatte. Wenn es belegte Brote gab, fast immer fanden sich welche, bei denen schon Schimmel am Belag oder dem Brot selbst war. Der oft faulige Geruch der Wurst auf den Broten war schon abschreckend genug. Als Gast hatte man es leichter, man wurde ja nicht zum Essen gezwungen, aber die Kindheit dort stelle ich mir schon etwas schwierig vor. Trotzdem ist aus allen was geworden und der Opa hats auch überlebt, hätte die Oma jetzt stolz gesagt. Vielleicht ja auch gerade deshalb, weil das auf Dauer abgehärtet hat und die Leute stabiler wurden? Mimosen hätten unter den Bedingungen erst gar nicht überlebt, sagte sogar vor Jahren ihre jüngste Tochter einmal.
Es gibt keinen Grund zu schimpfen, dass ich mit diesem Erinnerungsbericht meine beiden Großmütter in den Dreck ziehen würde. Sie waren ansonsten auf ihre spezielle Weise großartige Menschen, die eine gewisse Lebensleistung vollbracht haben. Man muss auch sehen, zu welch schwierigen Zeiten sie damals ihre Familien durchbrachten, es war zur Zeit des zweiten Weltkriegs und direkt danach. Da war keine Zeit für Anspruchsdenken und genau das zeigt der Leitspruch von Oma Marianne sehr deutlich: Essen muss nicht schmecken, sondern satt machen! Für mehr blieb damals keine Zeit und für mehr war damals auch nicht das notwendige „Material“ vorhanden. Wer dann den Großteil seines Lebens so gekocht hat, der ändert das auch später meistens nicht mehr, wenn wieder mehr möglich wäre.
Ich zucke heute immer etwas zusammen, wenn ich z.B. bei Kochsendungen im Fernsehen das Zitat höre: Das schmeckt wie bei Großmutter!
Ich sage dann immer: lieber nicht, alles, bloß das nicht!
....
|
|